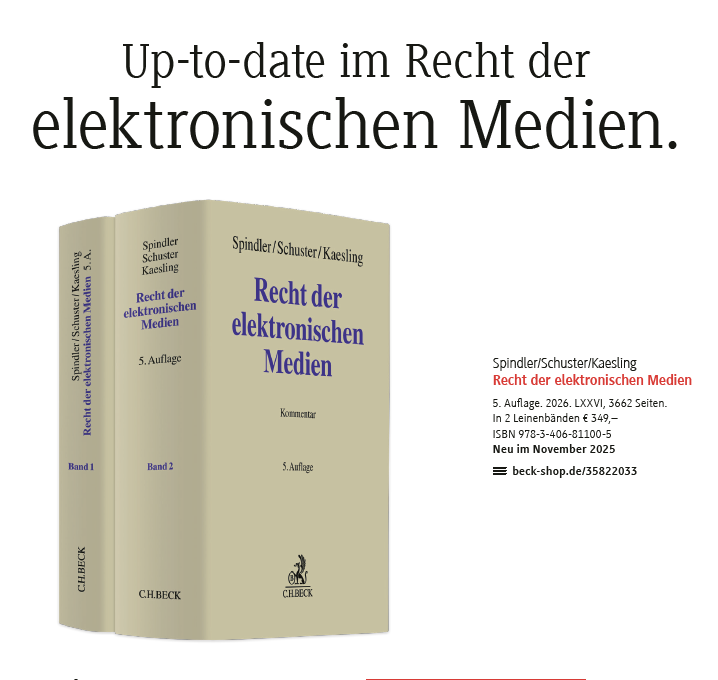Diesen Sommer hat sich das Verwaltungsgericht Köln erneut zum Antrag auf offenen Netzzugang geäußert. Die Entscheidung erging im vorläufigen Rechtsschutz gegen eine Entscheidung der Bundesnetzagentur im Streitbeilegungsverfahren (Aktenzeichen 1 L 372/24). Das Gericht sieht hier schon keinen ausreichenden Antrag des Nachfragers im vorbehördlichen bilateralen Verhandlungsverfahren.
Der spätere Antragsteller des Streitbeilegungsverfahrens hatte sich an die Antragsgegnerin mit der Bitte gewandt, in einem bestimmten Gebiet zunächst Informationen über die öffentlich geförderte Infrastruktur bereitzustellen. Anschließend wollte er aufbauend auf diesen Informationen einen offenen Netzzugang nach § 155 TKG zu den öffentlich geförderten Netzen verlangen. Da es nicht zu einer Einigung kam, rief der Antragsteller die Bundesnetzagentur an und begehrte den Erlass einer verbindlichen Entscheidung, den diese im Anschluss auch erließ.
Die Förderbedingungen sehen ebenso wie § 155 TKG zunächst vor, dass der Betreiber der geförderten Netze Nachfragern den offenen Netzzugang zu wettbewerblichen Bedingungen gewährt. Daneben und separat regeln die Förderbedingungen einen sogenannten förderrechtlichen Informationsanspruch. Dieser steht systematisch neben der Pflicht zur Gewährung des offenen Netzzugangs. Er ist nicht direkt als solches im Wege des Streitbeilegungsverfahrens vor der BNetzA einbringbar.
Dieses Verhältnis zwischen dem Anspruch auf offenen Netzzugang zu geförderten Netzen einerseits und dem eigenständigen förderrechtlichen Informationsanspruch andererseits verursachte nunmehr auch in der vorliegenden Entscheidung Probleme. Der förderrechtliche Informationsanspruch müsse eigenständig durchgesetzt werden, so das Verwaltungsgericht, ohne dabei einen konkreten Weg zu benennen. Der Weg des Streitbeilegungsverfahrens sei derzeit noch nicht eröffnet. — Dies kann sich dann aber wiederum ändern, sollte der deutsche Gesetzgeber an seinen derzeitigen Plänen für eine Ausweitung des Streitbeilegungsverfahrens festhalten.
Aufgrund dieses Verhältnisses zwischen den beiden Ansprüchen sieht das Verwaltungsgericht auch keinen ausreichenden Antrag im vorherigen bilateralen Verhandlungsverfahren. Ein solcher müsste so ausgestaltet sein, dass der Verpflichtete in die Lage versetzt wird, unmittelbar ein Angebot zu erstellen, das die wesentlichen Vertragsbestandteile enthält. Dies setze begrifflich schon einen gewissen Grad der Konkretisierung voraus. Der Antrag hier war aber noch nicht konkretisiert und zudem von der erst noch erhaltenen Information abhängig gemacht worden. Systematisch sei er hier also erst nach der erfolgreichen Informationserteilung gestellt worden, so das Gericht.
Für die Praxis kann diese Entscheidung verschiedene Folgen haben: Ein Antrag sollte zunächst möglichst konkret und bestimmt sein. Er sollte zudem nicht bedingt sein oder den Anschein erwecken, dass er erst zukünftig gestellt würde. Das Begehren sollte so deutlich formuliert sein, dass der Antragsgegnerin in der Lage ist, ein Angebot auf Vertragsabschluss im privatrechtlichen Sinne zu unterbreiten. Da ein solches die sogenannten essentialia negotii enthalten muss, muss der Antragsteller hier schon auf möglichst vollständige und umfassende Informationen hinwirken. Das kann sachlich aber die Nachfrage nach verschiedenen Vorleistungen umfassen.
Es wäre auch nicht ausgeschlossen, einen diesen Anforderungen genügenden Antrag zu stellen, wenn einige abschließende Informationen bislang noch fehlen oder streitig sind. Zwar darf ein verpflichtetes Unternehmen nicht dazu verpflichtet werden, einen Netzzugang zu gewähren, der ihm überhaupt nicht möglich ist. Diesen Einwand kann es aber ohne weiteres dadurch geltend machen, dass es ein Angebot über einen nachgefragten Antrag teilweise nicht unterbreitet, zu diesem Antrag Stellung nimmt oder schlicht einen Vorbehalt der Verfügbarkeit aufnimmt. Diese Verfügbarkeit kann ein Antrag auf offenen Netzzugang jedoch ebenso schon zum Gegenstand machen. Und schließlich wäre der Einwand der nicht ausreichenden Informationen missbräuchlich, da der Verpflichtete zum einen wegen des förderrechtlichen Informationsanspruchs zu ihrer Erteilung verpflichtet ist und zum anderen sich ein diesem entgegenstehender Zwangslizenzeinwand im Zusammenhang mit dem Marktmachtmissbrauchsverbot ergibt.